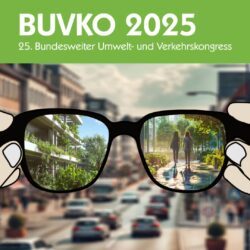Bis 2029 sollen mindestens 70 Prozent der Fernzüge der Deutschen Bahn pünktlich fahren, im Nahverkehr soll die Pünktlichkeit der Züge „dauerhaft“ bei 90 Prozent liegen. Daran wolle er sich messen lassen, sagte Patrick Schnieder bei der Vorstellung der „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ in Berlin. Wie will der Bundesverkehrsminister das schaffen?