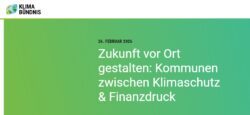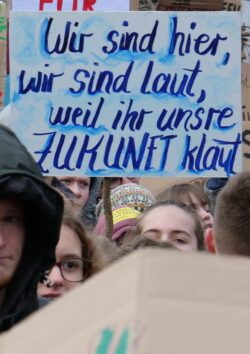In Belém tagt die UN-Klimakonferenz (10.11.-21.11.), die sogenannte COP30. Als Austragungsort für den zum 30. Mal stattfindenden Gipfel ist die brasilianische Stadt am östlichen Rand des Amazonasgebiets treffend gewählt. Seine weltweit größte zusammenhängende Regenwaldfläche ist als Kohlenstoffsenke für den Kampf gegen den Klimawandel von enormer Bedeutung – wenn seine wunderbare Baumbiodiversität erhalten bliebe.
Die Entwaldungsrate bis 2030 auf null Prozent zu reduzieren, hat sich Brasilien öffentlich auf die Fahnen geschrieben. In den ersten zwei Jahren der Lula-Regierung soll die Abholzung in Amazonien schon deutlich zurückgegangen sein. Doch der Regenwald habe unter dem immensen Druck globaler Wertschöpfungsketten möglicherweise bereits den Kipppunkt erreicht, den „point of no return“, ergab eine Studie, die das Fachblatt Nature 2024 veröffentlichte. Was kann man nun, zehn Jahre nach dem Pariser Abkommen, von der COP30 in Brasilien erwarten?